Infraswitch
Schalten mit Infrarotlicht
Dieser Text ist auch
als PDF-Datei verfügbar :
|
Infraswitch |
Dieser Text ist auch |
|
|
Die Ausrüstung konventioneller Fernsteuersysteme mit (zusätzlichen)
Schaltkanälen ist oft nicht möglich (Einfach-Anlagen) oder recht teuer
(Sendemodul mit Schaltern, Empfangsmodul-Multiswitch). Die meisten
Schaltfunktionen werden nur gelegentlich und dann auch im Nahbereich
genutzt. Hier kam die Idee auf, eine handelsübliche Universal-Fernbedienung
für die Unterhaltungselektronik zu verwenden. Freiweg nach dem Motto:
'Was mein Fernseher versteht, sollte man auch so auswerten können...'. |

|
Am Anfang stand eine Untersuchung diverser Universal-Fernbedienungen. Diese
sind dafür ausgelegt, die verschiedensten Geräte der Unterhaltungselektronik zu
unterstützen und können entsprechend eingestellt werden. Dabei kann man immerhin
etwa 50 bis 100 verschiedene Codes einstellen. Nach einem ersten Herumstochern
fiel die Wahl auf das Modell CV 150 von Conrad Elektronik. Günstiger Preis und
flächendeckende Verfügbarkeit waren wesentliche Kriterien. Zunächst rückte ich dem
Teil mit einem "Profi-Oszilloskop" auf den Pelz und bastelte dann auch ein kleines
Computerprogramm zur Unterstützung. Die meisten Codes waren recht kompliziert und
ich konzentrierte meine Suche schließlich auf Einstellungen, die eine Codierung
nach dem "RC5-Code" verwenden.
|
|
Mittlerweile hat Conrad Elektronik das Modell CV 150 vom Markt genommen. Auch Nachfolgemodelle die einen eingeschränkten Betrieb ermöglichten sind nicht mehr erhältlich. |
|
-Die 'Mode' Taste (TV) kurz drücken -Dreistelligen Code aus der Tabelle eingeben. Die LED bestätigt jeden Tastendruck. -Bei gültiger Eingabe erlischt die LED, andernfalls blinkt sie für 3 Sekunden Weitere Informationen sind in der Bedienungsanleitung der Fernbedienung zu finden. |
|
Nun ein paar Worte zur Reichweite. Eine Sichtverbindung zwischen Sender und Empfänger ist natürlich Voraussetzung. Unter idealen Bedingungen (nachts, neue Senderbatterien) habe ich durchaus 15 bis 20 Meter erreicht. Für den Tagbetrieb sind 8 bis 10 Meter realistisch. Direkte Sonneneinstrahlung auf den Sensor kann die erzielbare Reichweite deutlich verringern. Somit ist zu empfehlen, dem Empfangsbaustein ein schattiges Plätzchen mit direkter Sichtverbindung zum Sender zu spendieren. |
|
Das vom Empfangsbaustein gelieferte Signal wird in einem Mikrocontroller verarbeitet. Je nach Jumpereinstellung reagiert das Controllerprogramm und steuert die Transistoren an. Die Transistoren können eine Last von max. 300 mA schalten. Man wird Kleinverbraucher wie kleine Glühlampen oder kleine Motoren damit direkt schalten und für größere Lasten ein Relais oder eine geeignete elektronische Lösung vorsehen. |
|
|
Die unterschiedlichen Betriebsarten
|
Nun verfügt die Fernbedienung ja über eine ganze Menge Tasten und man hat sicher unterschiedliche Anforderungen, damit die Ausgänge auf der Empfängerplatine zu schalten. Um diesen Wünschen gerecht zu werden, kann man die Platine in verschiedenen Modi betreiben. Die Einstellung erfolgt wie gewohnt mit Jumpern und ist der nebenstehenden Tabelle zu entnehmen. |
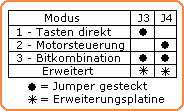
|
|
An dieser Stelle möchte ich auf das Demo-Programm auf meiner homepage hinweisen.
Wem diese Erklärungen zu langwierig oder unverständlich sind, der kann sich dort
spielerisch an das Thema herantasten. Kommen wir jetzt aber zur Erläuterung der einzelnen Modi: |
Modus 1 -Zifferntasten direkt-
|
Hier wirken die Zifferntasten direkt auf die Ausgänge. Dabei sind die Tasten 1 bis 9 den Ausgängen A bis I zugeornet. Beim Betätigen der jeweiligen Taste wird der entsprechende Ausgang umgeschaltet. Aus 'Ein' wird 'Aus' und umgekehrt. |
Modus 2 -Motorsteuerung-
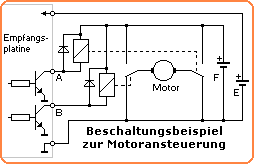 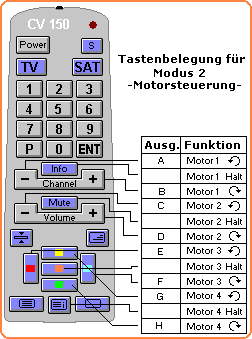
|
Vielfach wird auch eine Motorsteuerung erforderlich sein. Dabei werden die
Funktionen "Richtung 1" - "Halt" - "Richtung 2" erforderlich. Für den Motor
kann dies mit 2 Umschaltrelais realisiert werden.
Dabei ist für den Betrieb
entweder das eine oder andere Relais geschaltet. An der Fernbedienung sind
dazu die Kanal- und Lautstärketasten sehr gut geeignet. Mit den Tasten "Mute"
und "Info" wird der Motor gestoppt. 2 weitere Motoren können mit den farbigen
Tasten und der Taste unter der "grünen" bedient werden. Im Bild ist auch noch
einmal ein Beschaltungsbeispiel gezeigt. Wichtig ist dabei, dass die Massen
(Minus) von Empfangsakku (E) und Fahrakku (F) verbunden sind. Die Empfangsplatine
wird mit der Empfängerspannung (4.8v bis 6V) versorgt. Die Fahrspannung kann
durchaus höher sein - die Relais sind entsprechend zu wählen (Freilaufdiode
nicht vergessen). Übrigens kann auch die in SchiffsModell 3/2001 vorgestellte
Schaltung von Claus Föste angeschlossen werden. Der Infraswitch übernimmt
dann die Aufgabe des "Nautik-Expert-Bausteins". Dabei wird der mittlere Pin(rot)
an Plus des Akkus angeschlossen, die äußeren Pins (braun/orange) an die Ausgänge
des Infraswitch. |
Modus 3 -Bitkombination-
|
|
|
Vielleicht möchte man mehr als die gebotenen 9 Ausgänge nutzen und einzelne Ausgänge
direkt schalten, einige Motoren ansteuern und auch die Lichterführung realisieren ?
Kein Problem mit der Erweiterungsplatine. Sie bietet 16 weitere Ausgänge in 2 Blöcken.
Sie wird - neben den Versorgungsleitungen - an die Jumper 3 und 4 angeschlossen. Beim
Einschalten wird dies vom Controller der Empfangsplatine erkannt auf den Anschlüssen der
Jumper 3 und 4 werden nun Daten seriell ausgegeben. Die Bausteinen der Erweiterungsplatine
(einfache Schieberegister) stellen die Schaltfunktionen wie auf der Grundplatine über
Transistoren bereit.
Von der Grundplatine werden nun alle Modi unterstützt und folgendermaßen ausgegeben: |
|
|
|
Dem engagierten Bastler steht das nachfolgende Layout zum selbst Ätzen zur Verfügung.
Wer mit Lochrasterplatte arbeiten möchte, kann das Layout bei der Auslegung seines
Entwurfs heranziehen. |
Grundplatine - Bestückungsplan Grundplatine - Layout (Lötseite) 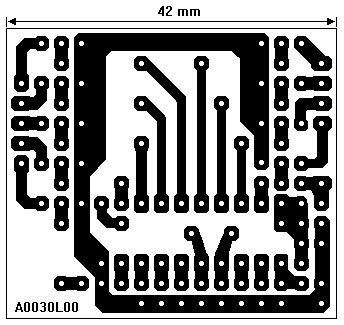
|
Erweiterungsplatine - Bestückungsplan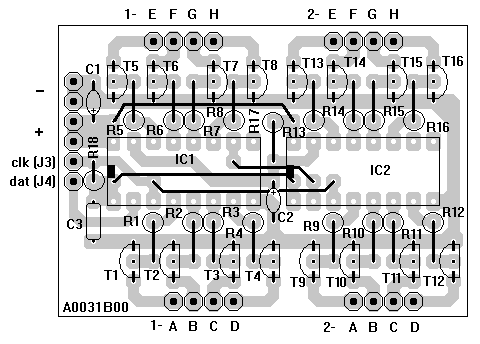 Erweiterungsplatine - Layout (Lötseite) 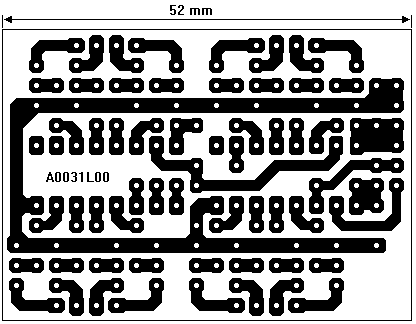
|
Oktober 2001 - © mnop, Karsten Hildebrand